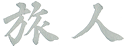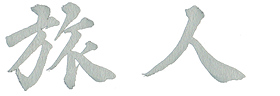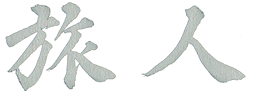Auch heute heißt es wieder: Volles Programm. Mit einem Schuss Ungewissheit, denn ich habe mir vorgenommen, den der Stadt Samarkand am nächsten gelegenen Grenzübergang zu nutzen, um nach Tadschikistan einzureisen. Da gibt es nur zwei mögliche Probleme: Erstens gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Grenzübergang (alle paar Tage fährt wohl ein Zug von Samarkand nach Duschanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, aber der fährt wirklich selten und macht einen riesigen Umweg). Und: Ich habe schon mehrfach gelesen, dass Ausländer gern auch mal an besagtem Grenzübergang abgewiesen werden, mit der Begründung, er sei nur für Anrainer, sprich Usbeken und Tadschiken. Das ist aber kein so großes Problem — sicher, ich habe ein Flugticket von Duschanbe nach Taschkent, dass ich sicherlich nicht mehr stornieren kann, aber so teuer war es nicht. Sollte es also nicht klappen, fahre ich einfach nach Samarkand zurück, verbringe hier einen vollen Tag und reise dann mit dem Zug zurück nach Taschkent. Das klingt sogar wie ein bisschen Urlaub! Vor der Abfahrt gibt es aber noch etwas zu erledigen. Da wäre zum einen erstmal ein kurzer Abstecher zum Frühstücksbuffet, denn das ist ausnahmsweise in meiner Buchung inbegriffen. Und dann wäre da noch Afrosiyob — genau, nach dem Ort wurde der Hochgeschwindigkeitszug benannt. Ein seltsam klingender Name. Am Vorabend hatte mich der Belgier nach meiner Route gefragt, und ich hatte ihm erklärt, dass Samarkand der Schwachpunkt in meiner Routenplanung sei, da ich nicht mal einen ganzen Tag in der Stadt habe, was definitiv zu kurz ist. Er kannte sich ein bisschen aus — und legte mir ans Herz, das ich auf gar keinen Fall Afrosiyob verpassen sollte — alles andere, selbst der prächtige Registan-Platz im Zentrum, sei egal.
Nun gut. Afrosiyob (manchmal auch Afrasiab geschrieben) liegt nicht so weit entfernt vom Hotel — definitiv in Laufweite. Ich konnte es nachts auch vom Hotel sehen. Dachte ich zumindest, denn was ich da sah, war in Wahrheit eine große, neue Moschee — Afrasiab liegt dahinter. Dabei handelt es sich um einen Hügel, auf dem sich eine größere Siedlung befand. Archäologen gehen davon aus, dass diese Siedlung, der Vorläufer des heutigen Samarkand, rund 500 vor unserer Zeitrechnung gegründet wurde und bis mindestens zum 12. Jahrhundert unserer Zeit bestand — bis im 13. Jahrhundert die Mongolen die Stadt überrannten und zerstörten. Heute gibt es dort unter anderem ein berühmtes Fresko zu sehen. Der Weg bis zum Museum entpuppt sich schnell als ziemlich lang, denn das Gelände ist groß, und das Museum befindet sich vom Stadtzentrum aus gesehen am hinteren Ende.
Das Gelände ist insgesamt rund 220 Hektar groß und und war von über 40 Meter hohen Mauern umgeben, von denen heute auch noch ein Abschnitt erhalten ist. Archäologen fanden hier Unmengen an Münzen, aber auch skythische Helme und andere Artefakte. Hier gab es auch mal einen Palast – und in den Überresten fand man ein großes Wandgemälde, und genau das (bzw. was davon übrig ist) wird in dem kleinen Museum ausgestellt. Das Gemälde wurde ziemlich wahrscheinlich rund um das Jahr 650 unserer Zeitrechnung erschaffen und zeigt, wie Botschafter verschiedener Regionen beim lokalen, sogdischen Herrscher vorsprechen – an den Gewänden kann man unter anderem chinesische, indische und persische Gesandte ausmachen. Das ist aufgrund des Zustands des Wandbildes nicht ganz einfach, aber beeindruckend ist es schon, zeigt es doch, wie schon damals überregional reger Handel herrschte. Der Eintritt in das Museum kostet 50’000 So’m, also gut drei Euro, und Audio-Guides gibt es auch. So enthusiastisch wie der Belgier es geschildert hatte, war ich etwas besorgt ob ich lange anstehen müsste oder Karten gar im Voraus reserviert werden müssen, jedoch: Ich war der einzige weit und breit.
Nun ist das Wandbild (und ein paar andere Exponate im Museum) zwar schon sehr interessant, aber richtig interessant wird es draußen, auf dem baumlosen und sehr gewellten Gelände der ehemaligen Stadt. So wie es aussah, kann man das Gelände möglicherweise auch betreten, ohne eine Museumseintrittskarte zu haben, denn draußen war keine Menschenseele zu sehen, die das kontrollieren könnte. Da war ich also, ganz allein auf den Ruinen einer mindestens 2500 Jahre alten Stadt. Dort gibt es auf den ersten Blick nicht viel zu sehen – einfach nur (unnatürlich) gewelltes Gelände, grasbewachsen. Aber hier und dort gibt es einen Aufschluss, und da wird es interessant: Da steht man vor einem 2-3 Meter hohen Aufschluss, aus dem von oben bis unten Dinge – hauptsächlich Keramikscherben – herausschauen. Wie alt mögen die Artefakte ganz unten wohl sein? Stammen sie aus der Zeit der Mongolen? Oder aus der Zeit Alexander des Großen, der ja hier auch durchzog? Ohne Radiokarbondatierung dürfte das schwer zu bestimmen sein. Aber einfach so vor meterhohen Schichten tausende Jahre dauernder Siedlunsgreste zu stehen ist ein seltsames Gefühl, zumal nichts daran erinnert: Es gibt keine Schautafeln, keine Absperrungen, keine Wächter – einfach gar nichts. Das macht mir aber gleichzeitig auch ein bisschen Sorge… man kann davon ausgehen, dass der eine oder andere mal eben etwas einsteckt. Das mache ich nicht, allein schon aus Ehrfurcht.
Nach einer Weile reiße ich mich dann doch los, denn die Uhr hält leider nicht an – außerdem brennt die Sonne erbarmungslos. Also verlasse ich das Gelände und laufe zurück, Richtung Stadt. Noch einmal vorbei an dem jüdischen Friedhof, denn Samarkand hatte einst auch eine große jüdische Gemeinde. Als ich wieder an der Moschee vorbeilaufe, telefoniere ich gerade mit meiner besseren Hälfte, als mich plötzlich ein Taxifahrer anspricht. Hmm. Ich werde wohl nicht umhin kommen, ein Taxi anzuheuern, also beginne ich, mit Russisch um den Preis zu feilschen. Aber wie ich es auch drehe und wende – er beharrt auf einen ziemlich hohen Preis, nämlich 400’000 So’m, also über 25 Euro. Bis zur Grenze sind es von hier rund 45 Kilometer. So gesehen kein so schlechter Preis, aber für lokale Verhältnisse trotzdem viel zu hoch. Ich lasse mich trotzdem darauf ein, denn er scheint ein interessanter Gesprächspartner zu sein. Also laufen wir zusammen zum Hotel zurück, wo ich mein Gepäck gelassen habe – er bietet sich an, das Gepäck zurück bis zum Taxi zu tragen – ein paar hundert Meter sind das, und direkt am Hotel kann man nicht parken – aber das muss nun wirklich nicht sein.
Wir brausen los, und zwar ziemlich zügig – unterwegs unterhalten wir uns über dies und das. Es geht quer durch topfebenes Land mit Feldern auf beiden Seiten und ein paar kleineren Städten. Er erzählt mir, dass man hier unter anderem Wein anbaut, der wohl auch sehr passabel sein soll. Auf den letzten Kilometer ist die Straße einfach nur kerzengerade – und die Berge am Horizont kommen immer näher – und sehen damit höher und höher aus, wobei man von hier noch keine schneebedeckten Gipfel erkennen kann.
Nach etwas mehr als einer Stunde — es ist schon fast halb zwölf — erreichen wir den Grenzübergang, und der sieht in der Tat nach einem sehr kleinen, lokalen Grenzübergang aus. Etwas baufällig, mit ein paar wartenden Autos und LKWs, die nicht nach sehr langen Strecken aussehen. Ein paar Geldtauscher lungern auf der usbekischen Seite, aber „Dank“ des gierigen Taxifahrers habe ich so gut wie kein usbekisches Geld über, und kirgisische So’m und andere Währungen werden nicht akzeptiert — der Wechselkurs für Japanische Yen ist in der Gegend auch sehr schlecht. Deshalb ein kleiner Tipp am Rande: Wer in dieser Gegend unterwegs ist, nimmt am besten eine Handvoll Dollar mit, als Notreserve, denn an oder in der Nähe des Grenzübergangs gibt es keine Geldautomaten.
Ich gehe zum ersten, kleinen Gebäude — dem Ausreisegebäude für Usbekistan. Eigentlich läuft das in Usbekistan so (wie auch in Russland): Der Ort der Übernachtung fragt nach dem Pass, und die Daten werden dann an die örtlichen Behörden weitergegeben — man wird angemeldet. Dann bekommt man einen kleinen Zettel vom Hotel, und die soll man sammeln, da man möglicherweise bei der Ausreise lückenlos nachweisen muss, wo man überall war. Übernachtet man bei Freunden oder Verwandten, muss man sich selbst bei der Polizei anmelden. Doch manche Hotels stellen die Zettel gar nicht mehr aus — entweder funktioniert also das elektronische Erfassungssystem ganz gut, oder die Regel ist mittlerweile obsolet. Man fragt mich jedenfalls nicht nach Papieren — man fragt gar nichts und stempelt einfach nur meinen Pass ab. Vor und hinter mir sind ein paar tadschikische Passinhaber, manche haben Tüten voll mit Non, dem usbekischen Rundbrot — sicherlich nicht, weil es bei ihnen kein Brot gibt, sondern als Souvenir. Nehme ich jetzt einfach mal an. Die Tadschiken, darunter eine sehr alte Frau, sind ein bisschen neugierig, aber ich merke schnell, dass nicht alle Russisch zu sprechen scheinen — vor allem die Jüngeren nicht. Es reicht aber, sich gegenseitig zu vergewissern, dass es heute ziemlich heiß ist.
Wir laufen zur tadschikischen Seite, und da begrüßt uns auch schon ein großes Foto vom „Führer der Nation“, wie sich Langzeitpräsident Rahmon gern bezeichnen lässt. Seit 1992 führt er das Land an — und aus dem Ausland gibt es viel Kritik, denn dort betrachtet man ihn als Diktator. Allzu laut will man das aber nicht Herausposaunen, denn Rahmon tut einiges dafür, dass sich der radikale Islam nicht weiter im Land ausbreitet. Und da Tadschikistan an Afghanistan grenzt, ist es geopolitisch durchaus relevant. Ach ja — vor wenigen Jahren gab es ein paar Scharmützel an der Grenze mit Kirgisistan, mit zahlreichen Toten. Man hat sich wohl auf höchster Ebene um eine Lösung bemüht und diese auch gefunden, aber die zahlreichen tadschikischen Exklaven in Kirgisistan sind wohl immer noch ein Stolperstein in den Beziehungen.
Die Einreise nach Tadschikistan erweist sich als äußerst unkompliziert. Während der Beamte seinen Landsleuten die eine oder andere Frage stellt, schaut er sich nur kurz meinen Pass an, dann schaut er mich an, sagt etwas wie “Ah, Germaniya!” – und drückt den Stempel in den Pass. Das war es auch schon. Und ich bin immer noch etwas überrascht, dass man mit einem deutschen Reisepass heutzutage wirklich fast überall hin kann – in allen vier -stan-Ländern auf dieser Reise braucht man kein Visum. Das war früher anders – meine alten Reisepässe sind vollgepflastert mit Visa, und die waren manchmal gar nicht so einfach zu bekommen. DIese Visa nahmen oftmals eine ganze Seite ein… und zählten zu den unabdinglichen Reiseerinnerungen. Natürlich habe ich all diese Reisepässe noch – sogar den aus der DDR, mit einem Visum für Bulgarien.
Kaum bin ich eingereist, werde ich, Überraschung, von Taxifahrern bestürmt. Es sind aber nicht viele, und es sind auch keine offiziellen Taxis, sondern eher semilegale? illegale? Sammeltaxis. Ich frage, was die Fahrt kosten wird – bis Dushanbe sind es immerhin gut 250 Kilometer, und zwar quer durch die Berge. Die Antwort: 250 Somoni, also rund 22 Euro. Will ich ein Auto ganz für mich allein haben, kostet das 1500 Somoni, also um die 135 Euro. Die Preisstruktur wundert mich ein bisschen, denn in ein Auto passen 4 Passagiere. 4 mal 250 Somoni macht 1000 Somoni – warum kostet es wesentlich mehr, ein ganzes Auto selbst zu mieten? Egal. Ich willige ein, denn der Preis scheint in Ordnung zu sein. Der Fahrer führt mich zu seinem Auto – ein Opel Astra (schon ewig nicht mehr gesehen!), und in dem warten schon zwei junge Tadschiken. Ich bin die Nummer #3, doch, und das ist typisch Sammeltaxi, wird das Auto nicht abfahren, bevor ein vierter Passagier gefunden wird. Also läuft der Fahrer wieder zum Grenzposten, um neue EInreisende anzusprechen – und er ist nicht allein. Nach 15 Minuten, in der sengenden Hitze eine Ewigkeit, überlege ich schon, ihm 500 Somoni anzubieten, damit er gleich losdüst, aber dann findet er doch noch Jemanden. Dem Fahrer hatte ich vorher schon zu verstehen gegeben, dass ich noch keine Somoni habe, aber er sagte, das sei kein Problem. Und so düsen wir los.
DIe Mitfahrer sind allesamt relativ jung und waren wohl ein paar Orte in Usbekistan besuchen – in der Region Samarkand/Buchara, denn dort wohnen mehr Tadschiken als Usbeken. Die Tadschiken sprechen im Prinzip Farsi, also die wichtigste Sprache des Iran – und sie verstehen im Prinzip auch Afghanen, denn die sprechen ebenfalls iranische Sprachen. Wir verständigen uns auf Russisch – mit Englisch haben es die Jungs nicht so. Sie sind dabei allesamt recht angenehm – überhaupt nicht aufdringlich, nicht geschwätzig, auch nicht mürrisch. Ganz normale Leute. Und so brausen wir los – immer weiter in die Berge hinein, gen Osten. Wir halten aber erstmal kurz in der grenznahen Stadt Pandschakent, wo der Fahrer auf eine Bank zeigt. Ah! Das passt ja. Ich hechte über die Straße und beginne mit dem Geldautomaten zu kämpfen, der sich aber weigert, Geld auszuspucken. Nach dem dritten Versuch gehe ich in die Bank, wo eine bildhübsche Angestellte auf sehr gutem Englisch fragt, ob es ein Problem gäbe. Ich erkläre ihr das Problem, und sie bittet mich zum Schalter. Dort gibt es ein kleines Kreditkartenterminal – ich muss dazu noch einen Zettel ausfüllen, und schon bin ich stolzer Besitzer von 1000 Somoni, wovon ich gleich ein Viertel dem Fahrer überreiche. Der scheint hier in der Stadt zu wohnen – er bringt schnell etwas nach Hause, und nun geht es richtig los.
Die Täler sind sehr grün, mit naturbelassenen Flüssen, und die Berge absolut kahl. Der Kontrast zwischen strahlend blauem Himmel, saftig-grünen Flusstälern und gelbbraunen, kahlen Gipfeln, später schneebedeckt, ist wunderschön. Bald verlassen wir das größere Tal und folgen dem schmalen und schnellen Fluss Zeravshan, der sich hier in tiefen Schluchten durch die Berge schlängelt. Nach rund 2 Stunden, wir sind in der Nähe des kleinen Ortes Wischkent, halten wir in einer Straßenkurve – hier gibt es zahlreiche Verkäufer sowie Toiletten. Es gibt die üblichen Snacks, aber auch viele Säcke mit…irgendwas drin. Wahrscheinlich Qurut (auch kurt, kashk usw.), der getrocknete Käse, aber auch getrocknete Aprikosen. Auf der anderen Straßenseite steht ein großer Kübel mit einer weißen Flüssigkeit – ab und zu geht jemand hin und taucht eine Plastikflasche hinein. Meine Mitfahrer kaufen das, und erklären mir, das sei sehr gut.
Für ein paar Somoni kaufe ich mir auch eine Halbliterflasche, und bin überrascht, dass das Getränk halbwegs kühl ist. Kühlschränke sehe ich keine — man nutzt einfach das an den Felswänden herunterlaufende Wasser als Kühlung. Der erste Schluck ist eine Offenbarung: Im Prinzip ist es Ayran, also ein leicht säuerlich schmeckendes Milchgetränk, hier mit einer Prise Salz und dazu auch noch mit Dill. Zumindest schmeckt es so. Sehr erfrischend, und es lässt mich auch schnell vergessen, dass ich seit 8 Uhr morgens nichts gegessen habe und sicherlich auch in den nächsten beiden Stunden nichts essen werden kann. Spaßeshalber gehe ich noch zur Toilette — das kostet eins, zwei Somoni — und bin heilfroh, dass ich hier kein größeres Geschäft verrichten muss. Zurück am Auto fragt mich einer der Mitfahrer, ob wir zusammen ein Foto machen können. Klar. Und los geht es wieder — gut die Hälfte müssten wir ja schon geschafft haben. Ein paar Kilometer weiter verkaufen Kinder Eimer mit Aprikosen darin – der Fahrer hält an, beginnt zu feilschen, und kauft letztendlich doch nicht – er schimpft nun eine Weile über die Kinder.
Die „Raststätte“ lag auf rund 1300 Meter Höhe. Ab hier geht es immer weiter bergauf, immer weiter an dem wild rauschenden Bach entlang. Die winzigen Siedlungen, die sich an den Bergen schmiegen, sehen sehr idyllisch aus — kleine und kleinste grüne Oasen. Eigentlich sieht die Landschaft hier exakt so aus, wie man sie aus Reportagen aus Afghanistan kennt — genauer gesagt dem Osten und Norden von Afghanistan. Das ist auch nicht verwunderlich, denim Süden grenzt Tadschikistan an Afghanistan. Für einen Moment stelle ich mir vor, wie es wäre, hier zu leben: Ziemlich abgeschieden, aber in einer kleinen Idylle. Sicher, die Winter dürften hart sein, aber es ist bestimmt ein erfülltes, wenn auch einfaches Leben. Nächster Gedanke: Plötzlich tauchen irgendwelche Ausländer auf, in vollen Kampfuniformen und mit schweren Waffen. Und sie machen Krawall. Brüllen herum, verhaften hier einen, töten dort einen. Würde ich wütend sein und dagegen etwas unternehmen? Aber hallo. In dem Sinne kann man die Afghanen nur verstehen, wenn sie nicht bereitwillig mit den ganzen Armeen dieser Welt kooperieren. Die Briten sind dort gescheitert, dann die Russen. Zuletzt die Amerikaner. Was suchen sie alle auch in Afghanistan. Aber ganz so einfach ist das natürlich nicht — es ist nur ein Gedankenspiel, was wohl wäre, wenn ich hier leben würde. Tue ich aber nicht. Meine (Wahl)Heimat ist eigentlich genau das Gegenteil von hier: Tokyo ist riesig, überall voller Menschen, bequem zum Wohnen, hektisch — und die Leute reden nicht miteinander.
Die Gipfel werden immer höher, hier und da kann,an schon etwas Schnee sehen. Ab und an kurbele ich die getönte Scheibe herunter, um ein Foto zu machen, aber der Fahrer brettert mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend, weshalb man die Scheibe nicht allzu lange unten lassen kann. Mein in der Mitte sitzender Nachbar stört sich nicht daran, im Gegenteil, er nutzt auch jeweils die Gelegenheit, um ein Foto zu machen. Nach einer ganzen Weile erreichen wir den rund 5 Kilometer langen Anzob-Tunnel, auch Istiqlol-Tunnel genannt, welcher auf gut 2700 m Höhe liegt — das dürfte der höchste Punkt an der Strecke sein. Der Tunnel ist etwas furchteinflößend – es ist stockdunkel darin, Seiten- oder Mittellinien kann man nicht oder nur kaum entdecken, und da er nicht beleuchtet ist, blendet der Gegenverkehr, so er denn überhaupt Licht anhat, umso mehr. Wir lassen den Tunnel endlich hinter us – ab jetzt geht es nur noch bergab. Wir sind mitten in der Serafschankette – ein hunderte Kilometer langes Gebirge mit bis fast 5500 Meter hohen Bergen. Eine atemberaubende Landschaft, an der man sich nicht satt sehen kann. Irgendwann werden die Berge jedoch immer niedriger, und wir kommen an einer Mautstation vorbei. Danach wird die Straße richtig gut und neu, und wir nähern uns langsam aber sicher der Hauptstadt von Tadschikistan, Duschanbe.
Das Auto hält an einer Bushaltestelle am Stadtrand – Endstation. Die Fahrt war sehr schön, aber es war eng, und so langsam habe ich auch richtig Hunger bekommen. Am Busbahnhof steht Чорбоғ – Chorbogh – ein Vorort. Hier in Tadschikistan benutzt man wiederum das kyrillische Alphabet, mit ein paar Sonderzeichen, um der tadschikischen/persischen Aussprache gerecht zu werden. Es ist 16 Uhr – und ich möchte unbedingt noch etwas von der Stadt sehen so lange es hell ist, denn, ja, es klingt brutal, am nächsten Tag geht es auch schon wieder zurück nach Taschkent. Ich bin also gerade mal einen knappen Tag hier. Aber ich will ja auch nur kurz schnuppern. Den Griff zum Handy kann ich mir sparen – die SIM funktioniert auch hier überhaupt nicht, und dummerweise habe ich die Offline-Karte der Gegend noch nicht heruntergeladen. Ich gehe zur Straße und halte ein Taxi an – ich bitte den Fahrer, auf Russisch, mich ins Zentrum von Duschanbe zu bringen. Er versteht nur Bahnhof. Englisch? Auch nur Bahnhof. Ich versuche “Zentrum” in allen möglichen Variationen zu sagen. Auch “zentraler Markt”. Es hilft alles nichts. Er ruft einen Übersetzungsservice an, aber selbst die können nicht wirklich gut Englisch sprechen. Der Fahrer versteht sicherlich das Wort Zentrum – aber er ist sich höchstwahrscheinlich nicht sicher, was genau ich mit Zentrum meine. Ich versuche es mit anderen Wörtern – beim Wort “Parlament” macht es klick, er wiederholt das Wort. Ich frage ihn, was es kosten wird – er zeigt auf das Taxometer. Oh, da ist mir Tadschikistan schon sehr sympathisch! Das habe ich schon an der Grenze gemerkt, wo auch andere Fahrer den Preis von 250 Somoni bis zur Hauptstadt sagten. Kein Feilschen – das ist der Festpreis, und den zahlen alle. Obwohl, einer von ihnen sagte aus Versehen 200, glaubte ich zu hören…
Wir fahren eine sehr lange Straße immer gerade aus. Er versucht mir viele Sachen zu zeigen und zu erklären, was nicht ganz einfach ist. Manchmal fährt er auch etwas langsamer, wenn er merkt, dass ich mit meinem Handy ein Foto machen will. Ein unglaublich netter und geduldiger Mensch. Eine halbe Stunde später sind wir an einem Ort, der definitv nach Zentrum aussieht: Eine große Kreuzung – ein großes Denkmal (das Ismail Samani-Denkmal – dieser war ein Herrscher und Eroberer im 9. Jahrhundert und gilt als “Vater des Vaterlandes” – nach ihm ist auch die Landeswährung benannt) sieht man hier, eine von Fahnen und großen Laternen gesäumte Allee, die Staatliche Bibiliothek sowie das nagelneue Parlamentsgebäude. Und den Rudaki-Park gibt es auch. Erster Eindruck: Sehr wenige Menschen, und alles ist tipp topp gepflegt und sehr sauber. So sauber, wie man sich Pjöngjang, Aschgabad und Asmara vorstellt, könnte man hier böse anmerken. Das ist nicht ganz fair, aber Fakt ist, dass die tadschikische Regierung bzw. der selbsternannte Führer der Nation das Land mit ziemlich harter Hand führt. Und aus Dank hängen auch vielerorts Portraits von ihm an Häusern und Wänden – die Zahl ist aber noch überschaubar.
Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll. Okay, vielleicht erstmal zum Ismael Somoni-Denkmal, die Treppen hochlaufen und von dort einen Überblick verschaffen. Auf halbem Wege sitzt ein Uniformierter, der mich heranwinkt. Er will meinen Pass sehen und fragt mich, was ich hier so treibe. Ich erkläre ihm, dass ich einfach nur ein Tourist bin, und er sagt irgendetwas über Deutschland. Dann sagt er mir, dass XYZ nicht erlaubt ist – doch was genau verboten ist, kann ich nicht verstehen. Sicherlich war es nicht in Ordnung, dass ich ein Foto gemacht habe, schließlich ist er vielleicht drauf zu sehen. Ich verabschiede mich und will weiterlaufen, als er plötzlich wieder irgendwas von Verbot sagt. Ah, okay. Man darf also nicht die Stufen rauf! Das hätte er doch gleich sagen können! Immerhin ist er freundlich geblieben.
Ich schlendere ein bisschen durch den gegenüberliegenden Rudaki-Park und beschliesse dann, die Rudaki-Allee nach Norden zu laufen – das ist exakt die Straße, auf der ich mit dem Taxi zum Zentrum gefahren bin. Warum? Unterwegs gab es ein paar interessante Gebäude, und es gab unterwegs auch einen Supermarkt, und da will ich auch noch hin. Essensgelegenheiten scheinen hier im Zentrum Fehlanzeige zu sein – hier ist das schicke Regierungsviertel und kein Ort, wo die Leute hingehen, um sich zu verlustieren. Das Zentrum an sich ist interessant – man scheint einen großen Teil der sowjetischen Bausubstanz abgerissen und durch moderne Gebäude ersetzt zu haben. Das ist ein großer Unterschied zu Taschkent, Almaty oder Bischkek. Das sieht alles ganz schmuck aus, aber auch ein bisschen steril – die paar verbliebenen Sowjetbauten erfrischen da beinahe das Auge. Und so laufe ich rund 2.5 Kilometer bis zu dem Supermarkt durch das beinahe menschenleere Zentrum. Es ist verdächtig menschenleer – aber ich komme später am Abend noch dahinter, warum: Es ist der erste Tag von Eid al-Adha, dem “Opferfest”, und quasi das für Moslems, was Weihnachten für Christen ist. Die Opfergaben müssen vorbereitet werden, die Kinder werden beschenkt – ein wichtiges Familienfest. Wohl deshalb ist hier nichts los. Am Supermarkt angekommen, gönne ich mir erstmal ein Eis – der erste Bissen seit 8 Uhr morgens, und es ist schon fast 18 Uhr. Vor dem Supermarkt räkelt sich eine Katze, die sicherlich auf die gekühlte Luft aus dem Inneren aus ist, denn auch in Dushanbe ist es ziemlich heiß im Juni, dabei liegt die Stadt auf rund 800 Meter Höhe.
Okay, ab ins Hotel, einchecken. Das liegt ziemlich weit entfernt, und ohne Internet das Bussystem zu durchschauen scheint schwierig. Da ich ja nun schon weiss, dass die Taxifahrer hier alle ehrlich sind, winke ich ein Taxi heran. Der ältere Mann muss erstmal lange auf seiner Navi und seinem Handy suchen, bis er die Adresse gefunden hat, denn 1) ist das Netz wirklich sehr langsam, und 2) scheint das Hotel sehr, sehr neu zu sein. Aber er findet es dann doch, und los geht es. Er schimpft ein bisschen – ständig wird irgendwo etwas Neues gebaut, er erkenne die Stadt kaum wieder. Wie es ihm im Allgemeinen denn so geht, will ich wissen – die Antwort: “Schlecht”. Er scheint unzufrieden, aber da sind wir dann doch schon am Hotel angelangt. Und das sieht richtig gut aus. Der Mann an der Rezeption des Sharq-Hotels ist sehr freundlich, erst recht, als ich ihm zwei Geldscheine gebe – er sammelt auf seinem Tresen Geldscheine von allen möglichen Ländern, und ich habe welche dabei, die er noch nicht hat. Das Zimmer ist vollkommen in Ordnung, die Anlage selbst auch – es gibt einen schönen Innenhof mit Singvögeln, die jemand dort in Käfigen hält. Ich lege mein Gepäck ab und ziehe wieder los – auf die Jagd nach einer Mahlzeit. Ich frage ihn, ob er ein gutes Restaurant empfehlen kann, aber er sagt, dass die traditionellen tadschikischen Restaurants für Familien ausgelegt seien – die Portionen seien zu groß für eine Person. Hmmm. Wie in Südkorea also – da ist es auch nicht einfach, ein Restaurant zu finden, in dem man allein essen kann, ohne zu platzen. Er empfiehlt ein türkisches Restaurant (überhaupt – die Türkei ist wirklich sehr präsent in der Region, davon zeugen die vielen Flüge in die Türkei, und die vielen türkischen Läden und Restaurants). Er kennt sogar eine Bar.
Gesagt, getan. Ich laufe die breite Druschby Narodow-Straße, die Straße der Völkerfreundschaft, Richtung Nordwesten. Es ist nun schon so gut wie Nacht, und jetzt sind deutlich mehr Leute auf der Straße. Es gibt zwei, drei größere Restaurants auf dem Weg, aber die scheinen für Hochzeiten und ähnliche Veranstaltungen gemacht zu sein – als einzelne, abgekämpfte Person traue ich mich da nicht rein. Das empfohlene türkische Restaurant, “Merve”, sieht aber gut aus, und der Hunger befiehlt mir jetzt auch, da reinzugehen. Pide & Co. sind richtig gut – endlich kann ich mir den Bauch vollschlagen. Auf der anderen Straßenseite, nur rund 100, 200 m entfernt, befindet sich dann auch schon die Bar. Duschanbinskii Pivsawod heisst die – “Duschanber Bierfabrik”. Und de Bierfabrik befindet sich wohl auch gleich dahinter. Bar? Nein, es ist eine Spelunke. Eine Kaschemme. Es sieht richtig übel aus. Es ist laut, schmutzig, und die meisten Gäste sehen ein bisschen zwielichtig aus. An der Wand hängt ein Leninporträt. Ich gehe zum Tresen und bestelle ein Bier – das kostet 5 Somoni (also 50 cent) und ist in 5 Sekunden gezapft. Ganz übel. Ein paar offensichtlich angeheiterte Tadschiken winken mich zu sich heran und beginnen, mich auf Russisch zuzulallen. Einer von ihnen erzählt mir, dass er “Gitler” für einen ganz tollen Typen hält (zur Erinnerung: Im Russischen wird aus einem H am Wortanfang ein “G”) – ein Anderer widerspricht ihm und versteht meine etwas genervte Reaktion. Die Kneipe erinnert mich an ostdeutsche Dorfkneipen (also zu DDR-Zeiten, versteht sich). Etwas heruntergekommen, verqualmt, laut, mit lauter Gestalten, die man hervorragend als Vorzeigepersonen nutzen kann, um Anderen die Schädlichkeit von Alkohol zu demonstrieren. Nach einem Bier, es ist kurz vor 9 Uhr, ist auch schon Feierabend – die Kneipe macht bereits zu.
Das ist vielleicht auch besser so. Ich laufe wieder zurück Richtung Hotel, dieses Mal eine andere Route. Dabei gelange ich zur Ayni-Straße – eine komplett neu gemachte Straße mit teuren Boutiquen, dem Dushanbe Hilton und so weiter. Der Ku-Damm von Duschanbe also, nur viel heller: Es sieht ein bisschen aus wie in Dubai oder Abu Dhabi, nur ohne Wolkenkratzer. Keine Frage – hier ist sehr viel Geld reingeflossen – ich nehme mal an, hauptsächlich aus dem arabischen Raum. Wow. Eine komplett andere Atmosphäre als in allen anderen Städten der Region.
Gegen 11 Uhr bin ich dann auch wieder zurück im Hotel – das ich erstmal suchen musste, da ja ohne Karte und ohne Internet. Wieder gut 25 Killometer gelaufen! Aber es hat sich gelohnt. Schade nur, dass ich es nicht zum Mehrgon-Markt geschafft habe, denn den hätte ich gerne besucht.